Kernaussagen: Wissenschaftliche Arbeiten vermitteln ihren Forschungszweck und ihre Ergebnisse häufig nicht klar genug – meist weniger aufgrund inhaltlicher Schwächen als wegen mangelnder sprachlicher Klarheit. Dennoch richten Autorinnen und Autoren ihren Fokus fast ausschliesslich auf den Inhalt. In diesem Artikel beleuchten wir die fünf häufigsten „Klarheitskiller“ im wissenschaftlichen Schreiben und zeigen, wie KI-Tools wie ChatGPT helfen können, sie zu überwinden. Ziel ist es, die Präzision und Verständlichkeit deiner wissenschaftlichen Stimme durch KI-gestützte Klarheit – nicht durch KI-generierte Inhalte – zu stärken.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wissenschaftliches Schreiben verbessert sich durch kontinuierliche Übung (Murray, 2023), scheitert jedoch selten an Grammatikfehlern, sondern vielmehr an Kommunikationsmustern, die Lesende von den zentralen Ideen distanzieren. Besonders in den Bildungs- und Sozialwissenschaften, wo Forschung politische Entscheidungsträger:innen, Praktiker:innen sowie diverse Interessengruppen erreichen soll, ist mangelnde Klarheit kein rein akademisches Problem – sondern ein Hindernis für Wirkung in der realen Welt.
Als wissenschaftliche:r Autor:in stehst du vor einer besonderen Herausforderung: Deine Arbeit soll den disziplinären Konventionen entsprechen und zugleich für ein gebildetes Publikum verständlich bleiben. Allzu oft wird „akademische Strenge“ jedoch so interpretiert, dass sie Klarheit, Persönlichkeit und Engagement aus dem Text verdrängt. Das Ergebnis: formal korrekte, aber kommunikationsschwache Arbeiten.
Es gibt viele Wege, wie wissenschaftliches Schreiben Leserinnen und Leser verlieren kann. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf fünf Muster, die uns in unserer Lektorats- und Lehrerfahrung immer wieder begegnen: Überqualifikation, passive Konstruktionen, unklarer Argumentationsfluss, Zitieren ohne Analyse und schwache Synthese in der Schlussfolgerung. Wir nennen sie unsere fünf Klarheitskiller.
Defensive Überqualifikation vs. gesundes Hedging
Das Problem: Wissenschaftliche Autor:innen sichern ihre Aussagen häufig über die sachlich notwendige Vorsicht hinaus. Während Hedging in der wissenschaftlichen Praxis als gesunde Vorsicht gilt, um Unsicherheiten korrekt zu kennzeichnen, bezeichnet Defensive Überqualifikation eine übertriebene, oft aus Unsicherheit resultierende Absicherung, die den Leser:innen eher Verwirrung als Klarheit bringt. Dieses Phänomen ist besonders problematisch in den Bildungs- und Sozialwissenschaften, wo Praktiker:innen klare Orientierung für die Anwendung benötigen.

Ein typisches Beispiel für defensive Überqualifikation lautet: „Die Daten deuten darauf hin, dass es einen Hinweis auf eine mögliche Beziehung zwischen der Variablen X und dem Ergebnis Y geben könnte, was möglicherweise die Hypothese stützen könnte, dass unter bestimmten Bedingungen Effekte beobachtbar sein könnten.”
Eine klarere Alternative wäre: „Die Daten zeigen eine moderate Beziehung zwischen X und Y (hier relevante Kennzahlen einfügen). Dies stützt Hypothese 1 und deutet darauf hin, dass zusätzliche Variablen den Effekt beeinflussen könnten.”
Warum das wichtig ist: Übermässiges Hedging ist kein Zeichen wissenschaftlicher Bescheidenheit, sondern Ausdruck unklaren Denkens. Leser:innen brauchen
Autor:innen, die auf Grundlage von Belegen eine nachvollziehbare intellektuelle Position einnehmen.
KI-gestützte Lösung: Nutze gezielte Diagnoseaufforderungen, anstatt vage Befehle wie „Fix my hedging“. Ein wirksamer Prompt könnte lauten: Analysiere diesen Absatz auf Qualifizierungssprache. Zeige mir, welche Absicherungen legitimer wissenschaftlicher Vorsicht dienen und welche das Argument unnötig schwächen. Betrachte mein Fachgebiet als [deine Disziplin]: [Text einfügen].
Wenn das Passiv die Oberhand gewinnt
Das Problem: Wissenschaftliche Autor:innen nominalisieren oft Verben und verwenden das Passiv übermässig, nicht aus stilistischen Gründen, sondern weil es sich „akademischer” anfühlt. Dadurch entsteht unnötig dichte Prosa, in der nicht klar wird, wer handelt und was getan wird.

Dichtes Muster: „Die Implementierung der neuen Methodik wurde durchgeführt, und es wurden signifikante Verbesserungen bei den Leistungskennzahlen beobachtet. Die Datenerhebung erfolgte über einen Zeitraum von sechs Monaten, in denen die Teilnehmenden regelmässig untersucht wurden.”
Klarere Alternative: „Das Forschungsteam implementierte die neue Methodik und beobachtete signifikante Leistungsverbesserungen. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurden die Daten gesammelt und die Teilnehmenden während des gesamten Studienzeitraums regelmässig bewertet.”
Warum das wichtig ist: Übermässiger Passivgebrauch steigert nicht die Präzision, sondern die kognitive Belastung. Leser:innen haben dadurch Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wer was, wann und warum getan hat.
KI-gestützte Lösung: „Analysiere den folgenden wissenschaftlichen Absatz. Identifiziere alle Passivkonstruktionen und beurteile für jede, ob sie einen legitimen wissenschaftlichen Zweck erfüllt oder das Verständnis unnötig erschwert. Überarbeite dann den Absatz so, dass die kognitive Belastung reduziert wird, der akademische Ton erhalten bleibt und Handlungsfähigkeit sowie Verantwortlichkeit klar gezeigt werden: [Text einfügen]“
Fehlender roter Faden in der Argumentation
Das Problem: Wissenschaftliche Autor:innen gehen oft davon aus, dass Leser:innen ihrer logischen Argumentation auch ohne explizite Orientierung folgen können. Das mag in hochspezialisierten Fachkontexten funktionieren, scheitert jedoch, sobald Texte ein breiteres, interdisziplinäres Publikum ansprechen sollen.

Unklare Struktur: Ein Absatz, in dem das Konzept A vorgestellt wird, gefolgt von einem Absatz, in dem drei Studien zitiert werden, gefolgt von einem Absatz, der Fragen zur Methodik aufwirft, ohne explizite Verbindungen zwischen diesen Schritten.
Transparentere Struktur: Jeder Absatz bezieht sich explizit auf das Gesamtargument, mit klaren Themensätzen und Übergängen, die die logische Beziehung zwischen den Ideen verdeutlichen.
Warum das wichtig ist: Vielfältige Leser:innen benötigen eine klare Orientierung durch komplexe Argumente. Sie sind zwar fachlich kompetent, aber nicht zwingend mit den spezifischen wissenschaftlichen Konventionen deines Fachgebiets vertraut.
KI-gestützte Lösung: „Bilde den logischen Ablauf dieser drei Absätze ab. Identifiziere die Hauptaussagen jedes Absatzes und erkläre, wie sie zusammenhängen, um die Gesamtargumentation voranzubringen. Schlage vor, wo explizite Übergänge oder Themensätze die Klarheit verbessern könnten: [Text einfügen]”
Zitate ohne Analyse
Das Problem: Wissenschaftliche Autor:innen nutzen Zitate mitunter als Ersatz für Analyse – in der Annahme, dass das Zitieren von Autoritäten bereits Argumentation sei. Das Ergebnis sind Literaturübersichten, die sich als originelles Denken ausgeben, es aber nicht sind.
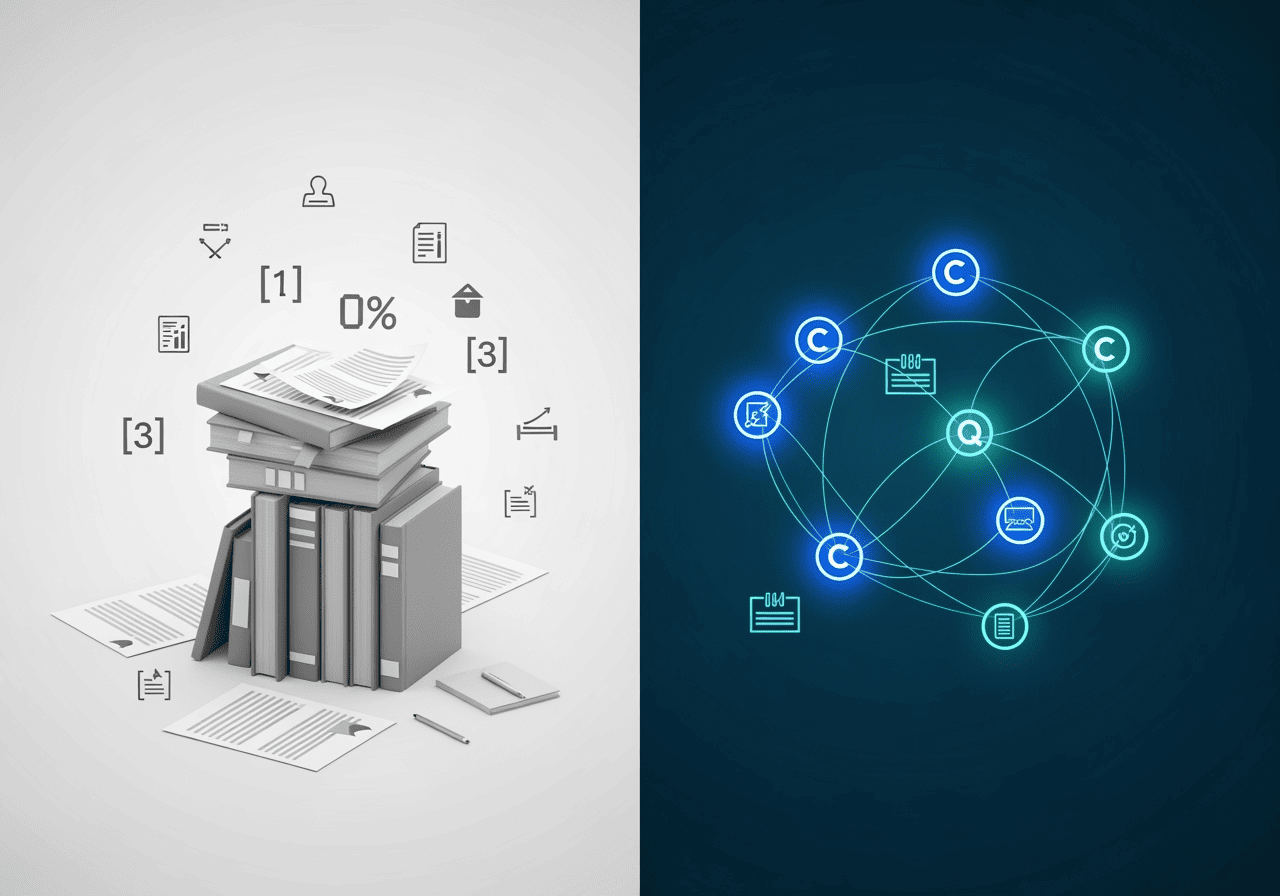
Zitatlastiges Muster: „Thema Z beeinflusst die Ergebnisse (Autor, Jahr; Autor, Jahr). Faktor A korreliert mit Faktor B (Autor, Jahr). Die Interventionen sind jedoch vielversprechend (Autor, Jahr; Autor, Jahr).”
Analytische Alternative: „Neuere Längsschnittstudien zeigen eine komplexe Beziehung zwischen den Faktoren A und B. Während Korrelationsstudien konsistent Zusammenhänge zwischen diesen Variablen nachweisen (Autor, Jahr; Autor, Jahr), legen experimentelle Interventionen nahe, dass kontextuelle Faktoren – und nicht allein die Häufigkeit – die Wirkung bestimmen (Autor, Jahr). Diese Unterscheidung hat erhebliche Implikationen für …”
Warum das wichtig ist: Zitate sollten die Analyse unterstützen, nicht ersetzen. Sie dienen dazu, Erkenntnisse zu vertiefen und auf ein klares Argument hinzuführen. Leser:innen müssen erkennen können, wie die zitierten Quellen miteinander und mit deiner eigenen Argumentation in Beziehung stehen.
KI-gestützte Lösung: „Untersuche, wie ich diese Zitate verwende. Führe ich die Quellen zu einem Argument zusammen, oder liste ich lediglich verwandte Forschung auf? Zeige auf, wo und wie ich eine tiefere analytische Synthese entwickeln könnte: [Text mit Zitaten einfügen]”
Das Problem mit zusammenfassenden Schlussfolgerungen
Das Problem: Wissenschaftliche Autor:innen behandeln Schlussfolgerungen oft als administrative Anforderungen und nicht als intellektuelle Möglichkeiten. Leider wird dadurch Die Chance verpasst, Forschung und Praxis zu verbinden.

Zusammenfassende Schlussfolgerung: „Dieser Beitrag untersucht drei Ansätze zur Problemstellung. Die Literatur wurde überprüft, die Daten analysiert und die Ergebnisse diskutiert. Die Befunde stützen die aufgestellte Hypothese.”
Eine bessere Syntheseartige Schlussfolgerung: „Die Ergebnisse stützen Hypothese 1, wonach die derzeitigen theoretischen Modelle die kontextuelle Variation des Phänomens unzureichend erfassen. Die identifizierte Drei-Faktoren-Interaktion weist auf ein dynamischeres Verständnis hin, wie sich Systeme unter Stress anpassen. Diese Erkenntnisse haben unmittelbare Implikationen für das Design von Interventionen und werfen grundlegende Fragen zur Konzeptualisierung von Resilienz in komplexen Systemen auf.”
Warum das wichtig ist: Starke Schlussfolgerungen fassen Ergebnisse nicht nur zusammen, sondern übersetzen Forschung in umsetzbare Erkenntnisse für Praktiker:innen und politische Entscheidungsträger:innen.
KI-gestützte Lösung: „Beurteile, ob diese Schlussfolgerung neue Erkenntnisse entwickelt oder lediglich bereits Gesagtes wiederholt. Welche weiterführenden Implikationen oder zukünftigen Forschungsrichtungen könnten den intellektuellen Beitrag stärken? [Schlussfolgerung einfügen]”
Fazit
Wissenschaftliches Schreiben dient der Wissensgenerierung und -vermittlung. KI-Tools können dir helfen, Barrieren zwischen deinen Ideen und deinen Leser:innen zu erkennen und zu überwinden. Die Verantwortung bleibt jedoch bei dir: klar, präzise und mit echter Auseinandersetzung über die Fragen zu schreiben, die deine Forschung antreiben – und für die Praktiker:innen, die von deinen Erkenntnissen profitieren.
Bist du bereit, dein wissenschaftliches Schreiben auf das nächste Level zu bringen? Fordere hier ein kostenloses Angebot an.
Wenn du Kommiliton:innen oder Kolleg:innen kennst, die mit ihrer Arbeit kämpfen, teile diesen Artikel mit ihnen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Bei diesen Ansätzen wird KI für analytisches Feedback verwendet, nicht für die Erstellung von Inhalten. Das Ziel ist eine transparentere Kommunikation deiner Ideen, nicht KI-generierte Prosa. Stell dir vor, dass ein ausgeklügeltes Lesegerät dir hilft, Kommunikationsbarrieren zu identifizieren, die du vielleicht nicht bemerkst.
Gib deinen disziplinären Kontext in KI-Eingabeaufforderungen (Prompts) an und gib dein Fachgebiet sowie deine Zielgruppe an.
Die meisten Institutionen unterscheiden zwischen KI-gestütztem Schreiben und KI-generierten Inhalten. Die Verwendung von KI zur Identifizierung von Kommunikationsproblemen in deinem Schreiben fällt in der Regel unter akzeptable Bearbeitungsunterstützung. Überprüfe jedoch immer die spezifischen Richtlinien deiner Institution und erwäge gegebenenfalls eine KI-gestützte Überarbeitung.
Teste das Verständnis, nicht nur den Stil. Bitte Kolleg:innen, dein Argument nach dem Lesen der überarbeiteten Abschnitte in eigenen Worten zu erklären. Wenn sie deine zentralen Punkte und deren Zusammenhänge präzise wiedergeben können, hat sich deine Kommunikation verbessert. Oberflächliche Änderungen, die das Verständnis nicht fördern, lohnen sich nicht.
Offenlegung: Dieser Artikel wurde von menschlichen Mitwirkenden erstellt. Generative KI-Tools wurden verwendet, um das Brainstorming, die Sprachverfeinerung und die strukturelle Bearbeitung zu unterstützen. Alle endgültigen Entscheidungen über Inhalte, Empfehlungen und akademische Erkenntnisse spiegeln das menschliche Urteilsvermögen und die Expertise wider.
Referenzen
Charlesworth Author Services. (2021, October 12). Scientific writing in English as an additional language (EAL): Presenting your ideas more clearly. https://www.cwauthors.com/article/scientific-writing-in-English-as-an-additional-language-EAL-how-to-present-your-ideas-more-clearly
Murray, R. (2023). Success in academic writing (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
Sword, H. (2012). Stylish academic writing. Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/file/feeds/PDF/9780674064485_sample.pdf
Dea ist Senior Researcherin und unterstützt Studierende dabei, sich sicher in der akademischen Welt zu bewegen. Sie erforscht, wie künstliche Intelligenz (KI) das wissenschaftliche Schreiben, Forschen und Lernen bereichern kann. Als Head of Partnerships bei Delta Lektorat leitet sie Kooperationen mit Universitäten, um akademische Exzellenz mit digitalen Innovationen zu verbinden.



