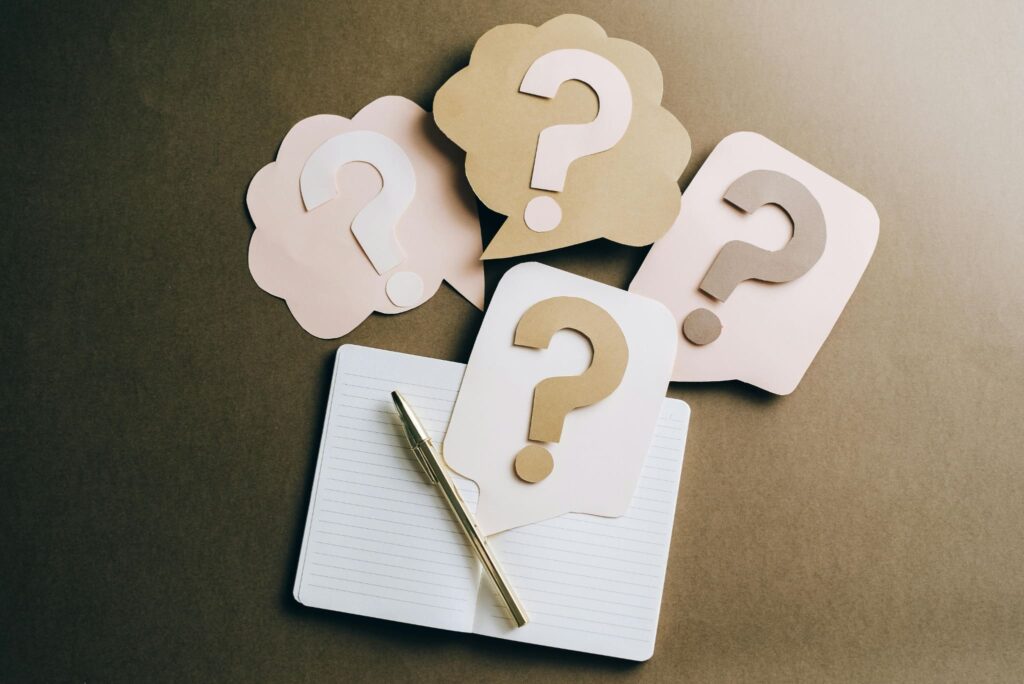Kernaussagen: KI-Tools können dir helfen, deine Formulierungen zu verbessern – aber sie können keine schwache Forschungsfrage retten. Viele Studierende an Hochschulen scheitern, weil sie mit der falschen Frage beginnen. Hier erfährst du, warum sich viele Abschlussarbeiten im Kreis drehen – und wie du mit einer klaren Methode aus diesem Kreislauf ausbrichst.
Inhaltsverzeichnis
Der wahre Knackpunkt beim Entwickeln einer guten Forschungsfrage
Eine starke Forschungsfrage ist klar, fokussiert, spezifisch, recherchierbar, relevant und originell. Sie sollte neue Perspektiven eröffnen oder zu neuen Erkenntnissen führen. Egal, ob du an der ETH Zürich, der Uni Bern oder an einer Fachhochschule studierst und gerade an deiner Abschlussarbeit sitzt – das Problem bleibt dasselbe: Vage Forschungsfragen kosten Zeit und Energie.
Stell dir vor, du gehst mit dieser Frage in deine erste Betreuungssitzung:
„Wie wirkt sich Technologie auf die moderne Gesellschaft aus?”
Nach dem ersten Feedback lautet sie vielleicht:
„Wie wirkt sich künstliche Intelligenz (KI) auf Studierende an Universitäten aus?”
Einen Monat später dann:
„Welche Auswirkungen hat künstliche Intelligenz (KI) auf die Lernergebnisse von Studierenden?”
Nochmals einen Monat später:
“Wie beeinflusst der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) das Prüfungsergebnis von Schweizer Wirtschaftsstudierenden?”
Einen weiteren Monat dann:
Burnout. Mehrere Supervisor-Meetings später, immer noch keine klare Richtung.
Das Problem ist hier nicht Faulheit oder fehlende Anstrengung. Vielleicht hast du sogar monatelang an deiner Forschungsfrage gefeilt. Bei Delta Lektorat erleben wir das immer wieder: Studierende, die ihre vagen, zu breiten oder kaum beantwortbaren Fragen in etwas weniger vage Varianten verwandeln – und dabei unbemerkt Monate und wertvolle Inhalte verlieren. Der häufigste Fehler: Der Griff zu KI-Tools in der Hoffnung auf eine Lösung. Doch das verschleiert das eigentliche Problem – und macht alles nur komplizierter.

Warum KI schlechte Forschungsfragen oft noch verschlimmert
KI ist ein Polierer, kein Problemlöser. Wenn du KI mit einer schwachen Forschungsfrage fütterst und es bittest, sie zu „verbessern”, bekommst du wahrscheinlich nur mehr Schlagwörter ohne Substanz, perfekte Grammatik für eine leere Idee – und zehn Varianten derselben Sackgasse. Es ist, als würdest du einen Taschenrechner bitten, deine Rechnung zu korrigieren, obwohl du die Formel gar nicht kennst. Die Ausgabe sieht ordentlich aus, aber das Fundament bleibt fehlerhaft.
Hier sind einige klassische Warnsignale für problematische Forschungsfragen, die wir immer wieder sehen:
Die Erste ist die Alles-Frage: Sie ist so breit gefasst, dass sie niemals in eine Abschlussarbeit passen kann. Du könntest darüber eine ganze Doktorarbeit schreiben, und trotzdem würdest du nicht alles abdecken. Dann gibt es die Google-Frage: Sie wurde online schon unzählige Male beantwortet und lässt kaum Raum für eigene Forschung oder neue Erkenntnisse. Ein dritter Klassiker ist die Buzzword-Bingo-Frage: Sie klingt beeindruckend, bleibt aber unkonkret und kaum messbar. Und schliesslich gibt es noch die Impossible-Mission-Frage: Eine Idee, die für eine Bachelor- oder Masterarbeit schlicht zu ehrgeizig und unrealistisch ist.
Wenn deine Forschungsfrage in eine dieser Kategorien fällt, hör auf, sie weiter zu verfeinern. Fang lieber neu an.
Die effektive Methode
Anstatt der KI das Denken zu überlassen, nutze deinen eigenen Denkprozess – und schreib dir diese Punkte ehrlich auf:
- Was du wirklich herausfinden möchtest – nicht, was besonders akademisch klingt
- Warum dir das Thema persönlich wichtig ist
- Was du mit deiner Zeit und deinen Fähigkeiten realistisch untersuchen kannst
Beispiel: Statt „Ich möchte KI in der Bildung untersuchen” könntest du sagen: „Ich möchte verstehen, warum manche Studierende ChatGPT nutzen, um ihre Aufsätze zu verbessern, während andere es komplett vermeiden.”
Mach es schmerzhaft spezifisch – also wirklich klar, konkret und greifbar.
- Generisch: Wie beeinflusst ChatGPT das Lernen von Studierenden?
- Konkret: „Wie nutzen Studierende ChatGPT beim Verfassen von Aufsätzen, und welchen Einfluss hat dies auf ihre Überarbeitungsstrategien?”
Jetzt hast du ein klares wer, was, wo und wann.
Teste deine Forschungsfrage mit der „Na und?”-Regel.
Stell dir vor, dein skeptischster Kollege fragt: „Na und? Warum sollte das irgendjemanden interessieren?”
Dann überlege:
- Kann ich diese Frage mit meinen aktuellen Fähigkeiten und meinem Zugang beantworten?
- Habe ich realistische Datenquellen (z. B. Studierendenbefragungen, Essay-Entwürfe, Feedback von Betreuenden)?
- Kann ich eine Methode entwerfen, die ich innerhalb meines Zeitplans umsetzen kann?
Wenn die Antwort nein ist, schränke die Frage weiter ein.
Verwende bewährte arbeitsfreundliche Formate.
- Vergleichsfrage: „Wie unterscheidet sich die Nutzung von ChatGPT beim Schreiben von Arbeiten zwischen Studierenden der Pädagogik und der Informatik?” Das hilft dir, Muster zwischen verschiedenen Studierendengruppen zu erkennen.
- Change-/Impact-Frage: „Wie hat sich seit der Einführung von KI-Erkennungssoftware an unserer Universität die Art und Weise verändert, wie Studierende ihre Aufsätze überarbeiten?” So kannst du dich auf beobachtbares Verhalten konzentrieren, statt auf vage Einschätzungen der Qualität.
- Widersprüchliche Frage: „Warum empfinden Studierende beim Einsatz von ChatGPT für ihre Aufsätze mehr Sicherheit, obwohl Lehrende diese häufig schlechter bewerten?” Das hilft dir, die überraschende Lücke zwischen Gefühl und tatsächlichem Ergebnis zu untersuchen.
Diese Fragen sind eng gefasst, beantwortbar und helfen dir, eine präzise Forschungsfrage zu formulieren, die auch von deiner Betreuungsperson und deinen Kommiliton:innen leicht verstanden wird.
Schliesslich kannst du KI nutzen, um deine Forschungsfragen kritisch zu hinterfragen und zu verbessern.
Beispiel-Prompt: „Bewerte meine Forschungsfrage: [füge hier deine Forschungsfrage ein]. Welche potenziellen Schwachstellen oder blinden Flecken siehst du, und wie könnte sie für Klarheit, Relevanz und Beantwortbarkeit optimiert werden?”

KI kann keine solide Forschungsfrage für dich erfinden – aber sie kann dein Denken schärfen, sobald du eine formuliert hast. Du kannst damit Debatten überprüfen, Annahmen einem Stresstest unterziehen und blinde Flecken aufdecken.
Fazit
Sieh KI als deinen Sparringspartner, nicht als deinen Fragengenerator. KI kann beim Schreiben unglaublich hilfreich sein – wenn man sie bewusst einsetzt. Sie liefert Denkanstoesse, hilft beim Strukturieren und zeigt blinde Flecken auf. Doch gutes wissenschaftliches Schreiben entsteht dort, wo Mensch und Maschine zusammenspielen – mit kritischem Denken, Neugier und der eigenen Stimme.
Manchmal ist man aber auch einfach zu nah am eigenen Thema, um zu erkennen, was nicht passt. Hier kommen Expert:innen ins Spiel. Bei Delta Lektorat feilen wir nicht nur an Formulierungen. Wir unterstützen Studierende in der Schweiz, Deutschland und Österreich dabei, Forschungsfragen zu entwickeln, die beantwortbar, relevant und fundiert sind. Denn sobald deine Frage solide steht, bricht der Rest deiner Arbeit nicht unter einem schwachen Fundament zusammen.
Lade hier deine Thesis hoch oder kontaktiere uns direkt unter info@deltalektorat.ch und beginne damit, deine Abschlussarbeit auf ein solides Fundament zu stellen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
KI kann Sprache und Struktur verbessern, aber sie kann keine sinnvolle Frage ohne deinen kritischen Input erstellen. Eine starke Forschungsfrage entsteht aus deinem Verständnis des Fachgebiets, deiner Motivation und deinem Zugang zu echten Daten. KI hat diesen Kontext nicht. Nutze sie, um eine Frage zu testen („Ist das spezifisch genug?” oder „Welche alternativen Formulierungen gibt es?”), nicht, um sie von Grund auf zu erfinden.
Die meisten Arbeiten sollten sich auf eine Hauptfrage konzentrieren, die von ein bis zwei Unterfragen unterstützt wird. Die Hauptfrage definiert dein zentrales Untersuchungsziel; Unterfragen klären, wie du dorthin kommst (z.B. Ursachen, Auswirkungen oder Vergleiche). Wenn du mehr brauchst, ist dein Umfang wahrscheinlich zu breit. Frag dich in dem Fall: Könnte das zwei separate Studien sein? Wenn ja, engere den Fokus ein.
Ja, absolut – auf vorheriger Forschung aufzubauen ist ein zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit. Eine starke Frage entsteht meist aus einer Lücke oder Spannung zwischen vergangener und aktueller Forschung, z.B. wenn neue Technologien, Methoden oder gesellschaftliche Entwicklungen alte Erkenntnisse infrage stellen.
Das bedeutet, dass deine Frage noch versucht, zu viele Variablen, Gruppen oder Ergebnisse auf einmal abzudecken. Enger fassen heisst, Grenzen zu setzen, die die Arbeit machbar machen. Bei Delta Lektorat kommen wir genau hier oft ins Spiel: Wir helfen Studierenden, den Fokus zu finden, zu erkennen, was wirklich zählt, und breite Ideen in klare, verteidigungsfähige Forschungsfragen umzuwandeln.
Eine Forschungsfrage ist fertig, wenn sie klar, fokussiert, spezifisch, forschbar, relevant und originell ist. Wenn du deine Frage wochenlang verfeinerst und trotzdem feststeckst, oder wenn Feedback von deinem Betreuer immer wieder nur vage Hinweise wie „zu breit” gibt, kannst du professionelle Unterstützung nutzen, die dir hilft, blinde Flecken und verborgene Annahmen zu erkennen.
Offenlegung: Dieser Artikel wurde von menschlichen Mitwirkenden erstellt. Generative KI-Tools wurden verwendet, um das Brainstorming, die Sprachverfeinerung und die strukturelle Bearbeitung zu unterstützen. Alle endgültigen Entscheidungen über Inhalte, Empfehlungen und akademische Erkenntnisse spiegeln das menschliche Urteilsvermögen und die Expertise wider.
Referenzen
Qualtrics. (2025, April 5). How to write qualitative research questions (with examples). Qualtrics XM. https://www.qualtrics.com/experience-management/research/qualitative-research-question/
Litmaps. (2025, April 8). How to write a research question. Litmaps.
https://www.litmaps.com/articles/write-a-research-question
University of Alaska Fairbanks Center for Teaching and Learning. (2025, March 18). The art of crafting research question: Aligning the problem statement, goal and objectives, and research questions. UAF CTL. https://ctl.uaf.edu/2025/03/18/the-art-of-crafting-research-question-aligning-the-problem-statement-goal-and-objectives-and-research-questions/
Dea ist Senior Researcherin und unterstützt Studierende dabei, sich sicher in der akademischen Welt zu bewegen. Sie erforscht, wie künstliche Intelligenz (KI) das wissenschaftliche Schreiben, Forschen und Lernen bereichern kann. Als Head of Partnerships bei Delta Lektorat leitet sie Kooperationen mit Universitäten, um akademische Exzellenz mit digitalen Innovationen zu verbinden.